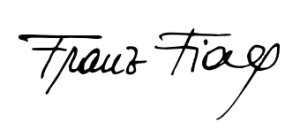Mein Vater Josef Fiala stammt aus ärmlichsten Verhältnissen. Der Vater Antonín war Schuster, der bis 1945 in einer Wohnungswerkstätte lebte und arbeitete. Die Mutter war Bedienerin und Stepperin.
Man nannte ihn „Pepperl“ oder „Pepíčku“. Für meine Großmutter, die mit immer „per Sie“ verkehrte, war er „der Fiala“, also er war wenig integriert. Und diese Distanz übertrug sich auch auf andere Verwandte, die dann ebenfalls „per Sie“ mit ihm waren, etwas meine Tante Milli und Hanni.
Die Fiala waren Tschechen aber sie waren bereit, alles Mögliche zu sein, wenn sie dafür nur mehr aufs Brot bekommen hätten. Die vier Kinder Anton, Josef, Sťepánka/Stefanie und Ludvík/Ludwig wollten versorgt werden.
Die Jugendzeit meines Vaters, die er mit dem Gustl, dem heutigen Herrn Hradil, verbrachte, muss arm und fröhlich zugleich gewesen sein. Zum ersten Mal hörte ich auch von einer meiner Urgroßmutter, Frau Moravetz. Diese Familie wohnte an der rechten Seite der tschechischen Kirche am Rennweg. Diese Nähe zur Kirche äußerte sich auch in einer Religiosität, die auch auf meinen Vater eingewirkt hat. Er war Ministrant und in einem der katholischen Jugendorganisationen der tschechischen Minderheit. Wenn man mit meinem Vater sprach, so klang in vielen seiner Äußerungen eine innere Religiosität mit, deren Wurzel wahrscheinlich durch die damalige Nähe zur Kirche gelegt wurde.
Es ist auch interessant, dass zwar die Großeletern tschechischer Abstammung waren aber damals schon die österreichische Staatsbürgerschaft hatten. Ein Nachteil für die Söhne. Anton war bereits beim damaligen Bundesheer und wurde in Hitlers Armee übernommen, mein Vater Josef wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn (?) eingezogen. Das war nicht bei alle Tschechen so; fast meine ich, dass es eine Ausnahme war, von der sich die armen Leute einen Vorteil erhofften. Beispielsweise waren weder meine Großeltern Kvaček, noch meine Mutter, auch nicht mein Onkel Carda österreichische Staatsbürger, da sie sich zwar als Österreicher fühlten aber eher als Großösterreicher alter Prägung, wo es nicht so wichtig war, welchem Landesteil im Detail man angehörte. Sie hatten auch wirtschaftlich keinen besonderen Nachteil dadurch, im Gegenteil meine Großmutter konnte es – auch ohne österreichische Staatsbürgerin zu sein – zu beträchtlichem Wohlstand bringen. Für die Fiala hieß es: ‚mitgegangen, mitgefangen‘. Mein Vater Josef: 7 Jahre Kriegsdienst, mein Onkel Anton Kriegsdienst und ‚Heldentod‘.
Für die Großmutter war die Zeit, in der die Kinder noch zu Hause waren, besonders schwierig, da die Ernährung kaum gesichert war. Später war sie halbtags bei einem Arzt in der unteren Ungargasse in Bedienung. Der Arzt war Jude und bewohnte eine große Wohnung in einem der ‚Patrizierhäuser‘, wie Herr Hradil sagte. Bei Hitlers Einzug in Wien musste der Arzt die Wohnung aufgeben und emigrieren, vermachte sie jedoch schriftlich und als Dank für ihre Mitarbeit meiner Großmutter. Dass dieses Schriftstück eines Juden damals keinen Wert hatte ist heute klar, damals auch, denn die Wohnung bekam ein anderer, ein bei der Partei besser angeschriebener Parteigenosse.
Später dann war meine Großmutter bei einer Lederwarenerzeugung als Stepperin beschäftigt, was die Situation der Familie verbesserte.
Bei Kriegsende wurden das Haus der Hradil total, die Khungasse 17 und besonders die Wohnung der Fiala teilweise zerbombt. Vater Hradil übernachtete einige Nächte in Telefonzellen.
Damals waren Staatsbürgerschaften noch nicht in der heutigen Form bekannt. Ein Wiener Tscheche war zu jenem Ort (in Böhmen, Mähren oder Slowakei) zugehörig, in dem er geboren war und hatte einen dortigen Heimatschein. Er durfte weiterhin in Wien leben, doch im Falle eines sozialen Notstandes hatte er sich an seine Heimatgemeinde und nicht an die Stadt Wien zu wenden. Meine Großeltern waren wahrlich in einem Notstand aber sich an die Heimatgemeinde zu wenden, war ihnen offenbar noch aussichtsloser als in Wien zu hungern.
Ich kenne zwei Mitschüler meines Vaters: Anežka Hradilová war eine Schülerin seiner Klasse und Gustav Hradil war sein bester Freund, der um ein Jahr älter war. Die Hradil waren vergleichsweise wohlhabend. Sie betrieben einen Milchvertrieb im 1. Bezirk. Berichtet wurde darüber, dass mein Vater die Hradil praktisch täglich am Abend im Geschäft besuchte und dort die Restmilch aus den Milchkannen austrank, weil er so hungrig war. Weitere Geschichten mit seinem Freund Gustav finden sich bei dessen Seite.
Wenn ich die Erzählungen von Gustav Hradil richtig verstanden habe, war Anežka dem Josef so gut wie versprochen. Aber das war eben vor dem Krieg.
Bemerkenswert ist der September 1934 als mein Vater die tschechische Hauptschule beendet hat (übrigens mit lauter Sehr Gut) und die Eltern einen weiteren Verdienst dringend hätten brauchen können. Mein Vater orientierte sich an seinem Freund Gustav, der die Handelsschule besuchte und statt eine Lehrstelle zu suchen, erschien er als 14-jähriger in der Handelsschule und beantragte die Aufnahme. Es ist ihm gelungen, auch ohne elterliche Zustimmung aufgenommen zu werden und er hat schließlich dieselbe Ausbildung wie sein Freund Gustav absolviert. Das war für die Familie damals eine schwierige Situation, da er als Lehrling oder anders Beschäftigter zumindest teilweise versorgt gewesen wäre, so aber den Eltern noch immer auf der Tasche lag.
Er muss die Schule 1937 oder 1938 abgeschlossen haben. Leider weiß ich nicht, ob er schon damals die Stelle beim Kartonagen-Firma Winter angetreten hat oder erst nach dem Krieg. Ob die bei diesem Link beschriebene Kartonagen-Firma Karl Winter die ist, in der mein Vater seinerzeit gearbeitet hat, werde ich versuchen, herauszufinden. Was aber sicher ist, dass eine Tochter oder Enkelin von Familie Winter im Haus Lorystraße 17 auf Tür 26/27 gewohnt hat. Das war ein reiner Zufall und da mein Vater zu dem Zeitpunkt schon verstorben war, kam es zu einen weiteren Kontakten.
Die Großeltern hätten sich als Tschechen deklarieren können, dann wären sie eben zu ihrer mährischen Heimatgemeinde zuständig gewesen. Sie haben sich aber als Wiener einbürgern lassen und damit wurden die Söhne automatisch im österreichischen Bundesheer wehrpflichtig. Wann genau diese Einbürgerung stattgefunden hat, weiß ich nicht aber der 1913 geborene Sohn Antonín konnte frühestens 1931 zum Bundesheer einberufen worden sein, es kann aber auch später gewesen sein. Mein Vater, der 1919 geboren wurde, wurde dann nicht mehr zum österreichischen Bundesheer sondern schon zur deutschen Wehrmacht einberufen.
Das hätte aber nicht sein müssen, denn Tschechen, die weiterhin mit tschechischem Heimatschein in Wien lebten, wurden nicht zum Wehrdienst einberufen, sondern wurden im Hinterland zu kriegswichtigem Dienst verpflichtet. Ein solches Beispiel war mein Onkel František/Franz Carda, der während des Krieges in einer Fabrik für Tonwarenerzeugung eingesetzt war. Er war damals 43 Jahre alt und hätte durchaus auch beim Militär dienen können, immerhin war er Fähnrich im Ersten Weltkrieg und damit sogar besonders „kriegsdienlich“.
Aber die Fiala waren eben Opportunisten und glaubten den Versprechungen von einer besseren Welt unter deutscher Führung und daher waren die Söhne im Kriegsdienst. Sohn Ludvík/Ludwig wäre eigentlich auf „fällig“ gewesen, doch hatte er einen Klumpfuß und war daher vom Militärdienst befreit.
Der ältere, Antonín, kam auch tatsächlich nicht mehr zurück und hinterließ seine Braut Elisabeth (Lisl), die noch weit in die 60er Jahre fallweise bei uns zu Gast war und danach nach Tutzing in Bayern Herrn Dietl heiratete.
Die Jahre, die mein Vater im Krieg verbracht hat, kann man an Hand von Dokumenten grob nachzeichnen. Er begann als Soldat aber durch seine Lernfreude ist er rasch aufgestiegen und war bereits zu einem Unteroffizierkurs angemeldet, zu dem es aber nicht mehr kam; der Krieg war zu Ende. Er war in der Fliegerabwehr am Rhein stationiert und von seinen Erzählungen sind mir zwei in Erinnerung geblieben:
Mein Vater Josef war in Neuss verlobt und zwar mit Eva Stapelmann, doch diese Beziehung war nur flüchtig, die Entfernung von Wien nach Neuss war doch recht groß.
Meinem Vater imponierte der Kölner Bahnhof. Wie dort auf engstem Raum ein große Zahl von Zügen oft auf geteilten Bahnsteigen abgefertigt wird, schilderte er als logistische Meisterleistung. Ich habe schon bei der Versuchsanstalt im Arsenal gearbeitet und bin im Zuge von Dienstreisen auch nach Köln gekommen und habe mir den Bahnhof genau angeschaut und ihm über meine Erlebnisse berichtet. Danach hat er mir erst erzählt, was genau ihn mit diesem Bahnhof verbindet. Es muss im letzten Kriegsjahr gewesen sein als das Bombardement der Alliierten eingesetzt hat und mein Vater auf dem Weg nach Wien in Köln umsteigen musste. Während dieses Aufenthalts kam er zu einem Fliegerangriff. Er fühlte sich in den Katakomben des Bahnhofs unter der Gleisanlage sicher und stand bei einem der Stiegenaufgänge zu den Bahnsteigen. Ohne besonderen Grund wechselte er den Standort und ging den Gang entlang Richtung Domplatz als hinter ihm eine Bombe einschlug und zwar genau an jeder Stelle, wo er vorher gestanden war. Es ist ihm weiter nichts passiert aber schaurig muss das Erlebnis doch gewesen sein. Ob er dann in den Dom gegangen ist, hat er nicht erzählt.
Nach dem Krieg arbeitete mein Vater in der Kartonagenfirma Winter (ob auch schon vor dem Krieg, weiß ich nicht, nehme es aber fast an). Bemerkenswert ist aber die enge Bindung an diese Firma. Seine Leistung muss beim Firmenchef Winter einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen haben, wie weiter hinten noch berichtet werden wird.
Die Großelterngeneration hatte noch irgendwie erlebt, dass eben Eltern die Ehepartner für die Kinder auswählen. (Für sie selbst ist aber keineswegs mehr zugetroffen, denn alle Geschwister meiner Großeltern waren sehr selbstbewusst und unabhängig.) Aber im Falle meiner Mutter war es eben so, dass es eine Bekanntschaft oder gar schon Verlobung mit Albín Kafka, einem Gärtner gab. Es gibt eine Menge (derzeit noch ungelesener Briefe), die weitere Details erzählen werden. Da mein Großvater ein Hobbygärtner war, hat er sich sicher mit Albín gut verstanden. Aber Albín war ehrgeizig und wollte mit seinen Kenntnissen ins Ausland. (Man muss bedenken, dass die Bindung vieler Tschechen, besonders jener mit nicht ortsfesten Berufen, an Wien durch die Diskriminierung während der deutschen Besatzung nicht sehr groß war. Dazu kam die hoffnungslos erscheinende Lage durch die Kriegszerstörungen. Wenn daher eine Neubeginn, dann kann man es auch unter besseren Startbedingungen versuchen.) Albíns Ziel war Kanada.
Für meine Mutter bedeutete das aber eine Zwickmühle, denn ihre Bindung an den Vater war sehr groß. Für sie wäre eine Auswanderung einem Verrat an den Eltern, insbesondere eben am geliebten Vater gewesen.
Jetzt kommt die tschechische Gesellschaft ins Spiel. Die Tschechen in Wien waren und sind – wahrscheinlich wegen der Kleinheit der Gruppe – ein sehr geselliges Volk, das keine Gelegenheit auslässt, sich zu treffen und zu feiern. Man sieht sich immer wieder; jeder kennt jeden. Ein Dorf inmitten der großen Stadt. Natürlich kannten die heiratsfähigen Girls auch den feschen Kriegsheimkehrer Josef und dessen Bruder Ludvík/Ludwig.
Mein Vater, ein ewiger Hungerleider, sah die Mädchen, sah aber immer auch das Paket; und er sah eine Lebensmittelhändlerin.
Wer die Beziehung meines Vaters zum Essen kannte, hätte wissen können, dass ihn das kulinarische Umfeld der Kvaček ähnlich stark angezogen hat wie deren Tochter Martha.
So kam es dann – gegen den Widerstand meiner Kvaček-Großeltern – zu der Eheschließung zwischen Martha und Josef in der Pfarrkirche Neu-Simmering.
Anfangs wohnten die Jung-Fiala in Haus der Mutter in der Sedlitkzygasse 14/8.
Ob die weitere Entwicklung bei der Eheschließung bereits kalkuliert wurde oder sich dann so ergab, weiß ich nicht. Jedenfalls war schon damals meine Großmutter nicht mehr im Geschäft in der Grillgasse 38 und meine Mutter führte das Geschäft. Dazu gibt es auch interessante Zeugnisse, ausgestellt von Lieferfirmen, die das Geschäft meiner Großmutter belieferten und bestätigen, dass meine Mutter schon seit ihrem 18. Lebensjahr die Abwicklung der Lieferungen geleitet hat.
Die einschneidendste Änderung im Leben meines Vater war der Wechsel vom Vertreter in der Kartonagenfabrik Winter in das Geschäft meiner Mutter als Geschäftsführer. Immer wieder wurde im Familienkreis diese Lebensumstellung als für ihn und für die Familie schädlich angesehen.
Ernährung
Es kam zu einer sonderbaren Hassliebe zwischen meiner Großmutter Julie und meinem Vater. Meine Großmutter war eine einfache Frau, die es gewohnt war, Entscheidungen nach Sprüchen auszurichten (nicht etwa nach religiösen Grundsätzen). Zum Beispiel nach der Regel: „Jak k jídlu, tak k dílu“, was übersetzt heißt: „Wie beim Essen so bei der Arbeit“. Dagegen ist im Prinzip nicht einzuwenden, denn wer (körperlich) arbeitet, bekommt Hunger und wird logischerweise auch beim Essen mehr zulangen.
Leider führte die umgekehrte Auslegung dieses Spruchs (er viel isst, wird (wahrscheinlich) auch viel arbeiten) zu einer rapiden Gewichtszunahme meines Vaters. Von 50 auf 100 kg in zwei Jahren. Unterstützt durch die erlebten Entbehrungen der Kindheit und der Kriegszeit, wo das Gewicht einfach durch das fehlende Angebot klein gehalten wurde, gab es jetzt, im Lebensmittel-El-Dorado ein unerschöpfliches Angebot auf der einen und gleichzeitig einen ebenso unerschöpflichen Appetit auf der anderen Seite.
Marillenknödel in Kritzendorf waren etwa so ein Highlight. Jeder bekam seine Portion von – sagen wir – vier Knödel + Brösel + Butter + Zucker versteht sich, nur mein Vater bekam eine Art Salatschüssel, in der zwanzig dieser Knödel Platz fanden – und auch gegessen wurden. Die Augen meiner Großmutter leuchteten, wenn sie das sah.
Hätte sie auch weitere Regeln beherzigt, wie zum Beispiel die der Sportler: „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“, hätte sie bald die Bremse angezogen aber diese Regel war leider nicht in ihrem Repertoire.
Es wäre aber viel einfacher gewesen: mein Vater hätte nur den Beruf als Kartonagen-Vertreter nicht aufgeben müssen, denn Kartonagen kann man nicht essen.
So aber erreichte mein Vater dann bald die 130 kg-Marke (und darüber) und das Unglück nahm seinen Lauf. Es gibt ja dicke Menschen, die als gemütlich gelten und mein Vater war durchaus auch gemütlich. Insgesamt aber muss er aber unter dieser unnötigen Belastung sehr gelitten haben. Körperlich sowieso, denn alle Tätigkeiten belasteten ihn auf Grund des Gewichts mehr, sodass der Spruch meiner Großmutter sich ins Gegenteil verkehrte. Aber auch im Umgang mit der Familie zog er sich zurück, denn jede zusätzliche Unternehmung, zum Beispiel ein Ausflug, was für ihn auch eine zusätzliche Belastung, die er dann durch schlechte Laune zum Ausdruck gebracht hat, d.h. das Familienklima war nicht zum Besten bestellt.
Briefmarken, eine Flucht aus der Realität
Seit seiner Jugend sammelte er gemeinsam mit seinem Freund Gustav Briefmarken. Während aber Gustav die Sache immer sehr pragmatisch gesehen hat und wertvolle Sammlerstücke auch einmal verkauft hat, um sich und der Familie einen kleinen Luxus bieten zu können, hat mein Vater ausschließlich gesammelt und sich von keinem der Sammlerstücke getrennt.
Beim Tod von Dr. Karl Renner 1950 stellte sich mein Vater um den damals von der Post aufgelegten „Renner-Block“ an, der den wertvollsten Teil der Österreich-Sammlung ausmachte. Seine Spezialität waren aber so genannte „Ganz-Sachen“ als tatsächlich gesendete Briefe. Zu jeder Neuerscheinung einer Briefmarke kaufte er nicht nur die Briefmarke selbst, sondern fertige Briefe an, die er an die diversen Sonderpostämter versandte, die dann dort mit Sonderstempel versehen wurden und wieder als echter Brief an ihn zurückgeschickt wurden. Sie waren dann Teil der Ganzsachen-Sammlung. Und es waren nicht nur gewöhnliche Briefe sondern viele davon waren auch eingeschrieben aufgegeben Briefe. Es gab auch sehr seltene Briefe wie „Ballonpost“ oder sogar „Raketenpost“.
Wenn mein Vater nach einem Arbeitstag, etwa um 19:00 Uhr nach Hause kam, saß er danach am Wohnzimmertisch (für einen eigenen Arbeitstisch war kein Platz) und arbeitete an den Briefmarken bei aufgedrehtem Fernseher bis zur Bundeshymne, oft aber bis zum danach folgenden Rauschen, weil er dabei eingeschlafen ist.
Ganz unverständlich war dieser Rückzug nicht, denn der Alternative, der Beteiligung an den Veranstaltungen der tschechischen Vereine (man könnte sie auch „Saufgelage“ nennen) wo meine Mutter alleine anzutreffen war, konnte er – mangels Gesprächspartner – nichts abgewinnen.
Für den Rest der Familie waren die Briefmarken ein völlig unverständliches Fachgebiet. Niemand unternahm einen Schritt in seine Richtung und diskutierte über Briefmarken; er war in dieser Welt allein.
Neugierde
Noch etwas hatte mein Vater mit seiner Schwiegermutter gemeinsam: beide interessierten sich für die Tagespolitik, lasen Zeitungen und meine Großmutter schätzte das. Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, die solche Diskussionen oft mit den Worte „belastet’s mich nicht damit“ abgebrochen hat.
Bei meinem Vater kam auch ein großes naturwissenschaftliches Interesse dazu. Er verfolgte alle technologischen Neuerungen mit großem Interesse und bedauerte oft, dass er diese Dinge nicht verstehe.
Folgendes Ritual spielte sich in der Mittelschulzeit ab. Ich hatte kein Fahrrad sondern einen grünen Trittroller mit Ballon-Reifen. Mit diesem Roller fuhr ich am Abend von der Lorystraße 17 in das Geschäft der Eltern in der Grillgasse 35 und ging dann mit ihnen langsam heimwärts. Bei diesen Spaziergängen erzählte mein Vater von der Astronomie, der Physik und von dem damals aktuellen Wettlauf der Amerikaner mit den Russen. Ich liebte diese Erzählungen, sie waren viel interessanter als etwa der Physik-Unterricht in der Schule.
Nach Hause angekommen gab es einmal das Vorabendprogramm um 19:00 dann die Uhr mit der Zauberflötenmelodie und danach die „Zeit im Bild“ mit dem Big-Band-Sound.
Es muss etwa in der Zeit um 1965 gewesen sein, als mein Vater sich fasziniert darüber gewundert hat, wie es dazu kommen kann, dass über ein mit nichts sonst verbunden Stückes Draht, der Antenne, ein Signal empfangen wird, dass zu einem Fernsehbild verwandelt wird. Er selbst könne dieses Wunder nicht verstehen und er bewunderte die Leute, die das konnten. Er hat nicht gesagt, ich müsse so etwas lernen aber für mich war es trotz Oberstufen-Physik-Unterrichts auch nicht klar und seine Neugierde war einerseits ansteckend und anderseits war sie wie ein unausgesprochener Auftrag, sich mit diesen geheimnisvollen Welten zu beschäftigen.
Es kamen auch andere Ereignisse dazu, etwa, dass schon ab der 3. Klasse Realschule in einer Gruppe elektronisch/chemisch gebastelt wurde und ich auch meine ersten Radios nicht zum Laufen gebracht habe – mangels Verständnis und mangels Sorgfalt aber ich habe später doch gelernt, worauf es ankommt.
Aber diese Erzählungen meines Vaters machten es schließlich aus, dass nach der bestandenen Matura kein Zweifel daran bestehen konnte, dass ich studieren wollte und auch das Fach war klar: Nachrichtentechnik. Dass mit die Berufsberatung davon wegen meines Dreiers in Mathematik abgeraten hat, war für mich keinerlei Ausschließungsgrund.
Die Erkrankung
Mein Vater war eigentlich „pumperlg’sund“, aber er war zu dick. Sogar das stark vergrößerte Herz konnte die erforderliche Pumpleistung nicht mehr erbringen und mein Vater bekam Wasser in die Beine und musste ins Krankenhaus. Dort war er einmal ziemlich verdattert darüber, mit wie wenig Nahrung man eigentlich auskommen kann. Er tat uns allen leid. Aber man hat ihm die beste Kur angedeihen lassen: kein Essen. Er kam danach nach Bad Tatzmannsdorf und er hat tatsächlich viel abgenommen. Nicht passte ihm mehr. Aber keine Angst, es hat nicht lang gedauert, und er war wieder der Alte. Bemerkenswert war aber die Zeit als „schlanker Josef“. Ich täusche mich nicht, denn in dieser kurzen Zeit hat sich auch sein Wesen sehr gewandelt. Der Missmut, den er (wegen des Übergewichts) oft aufgebaut hatte ist einer gütigen Freundlichkeit gewichen. Und trotz der Erneuten Gewichtszunahme hat er viel von dieser Freundlichkeit behalten.
Ausklang
In seinen letzten Lebensjahren, als ich bereits mit Silvia in der Nachbarwohnung Tür 9 wohnte, ist mein Vater direkt zu einem Familienmenschen mutiert, der sich nicht mehr nur in seine Briefmarkenwelt zurückgezogen hat, sondern sich über jeden unserer Besuche sehr gefreut hat und viele Stunden mit uns verbracht hat. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Ende des gar nicht einfachen Überlebenskampfs als Lebensmittelhändler absehbar war.
Ein – für seine Verhältnisse – unglaubliches Abenteuer war eine Fahrt nach Scheibbs zu meinen Schwiegereltern. Er zeigte sich dort von seiner nettesten Seite, war fröhlich und ich könnte mir gut vorstellen, dass er in dieser Form in seiner Jugend sowohl als Mitarbeiter als auch als Partner sehr begehrt gewesen sein muss.
Was mir jetzt noch auffällt: seine Lage in der Familie war schlecht, sein Gesundheitszustand war schlecht, er hatte dadurch oft schlechte Laune. Aber hat sich nie über etwas beklagt.
Dass er seine Pension nicht länger als ein Jahr konsumieren konnte, lag wohl an seinem jahrzehntelangem Leiden (1950-1980) an Übergewicht. Sehr oft waren unser erster Hausarzt Dr. Kolmann und danach Dr. Rauscha in unserer Wohnung mit immer derselben Diagnose, sich vom Essen zurückzuhalten: „Sie müssen abnehmen, Herr Fiala.“ Mein Vater hatte durch das große Übergewicht ein stark vergrößertes Herz und der Sekundentod war eine Folge dieser ständigen Überlastung des Herzens.
Er war einmal in der Woche bei seinen Briefmarkensammlerkollegen in einem Wirtshaus in der Geiselbergstraße (in jenem Haus, in dem zuletzt auch mein Onkel Richard gewohnt hat) und als er von diesem Sammlerabend nach Hause kam, fiel er einfach um und war tot.
Eigentlich wollte ich, dass er im Grab seiner Eltern begraben wird, doch meine Mutter bestand am Pohan/Kvaček-Familiengrab, weil sie selbst auch dort begraben werden wollte. Und so kam es dann auch.
Das Grab meiner Fiala-Großeltern habe ich schließlich der Familie meine Tante Mila überlassen.
Freunde
Mein Vater war verhältnismäßig einsam. Er hatte einen einzigen wahren Freund, Gustav Hradil, der im Alter auch für mich uns mein PCNEWS-Projekt zu einem kameradschaftlichen Begleiter werden sollte.
Bis zu seinem frühen Tod mit 50 Jahren war auch sein Bruder immer ein Mahner an seiner Seite.
Andere Freunde aus der tschechischen Gesellschaft, wie zum Beispiel seine Schulfreundin Anežka und ein Bienenzüchter, Herr Janík, lebten in der CSSR und Begegnungen waren schwierig und sehr selten.
So blieben ihm als Freunde seine Briefmarken.
Artefakte
Von meinem Vater besitze ich seine Rangabzeichen als Feldwebel bei der Deutschen Wehrmacht.
Einen besonderen Teil seiner Briefmarkensammlung, die Ersttagsausgaben mit einem erklärenden Text für jede Marke haben wir behalten.